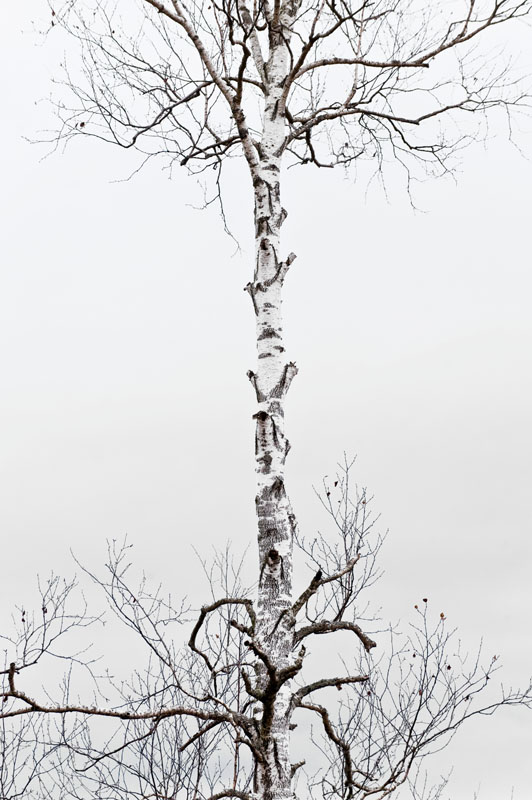
12 Dez. Das Gedächtnis gehört den Verletzlichen
In Danilo Kiš‘ Frühwerk „Psalm 44“, das nun erstmalig in deutscher Übersetzung vorliegt, wird die Geschichte der Jüdin Maria erzählt, die 1944 mit ihrem gerade einmal sieben Wochen alten Sohn Jan die Flucht aus dem Lager Birkenau wagt, um Jakob, den Vater des Kindes zu finden. Die Geschichte dieser Flucht wird immer wieder von Rückblenden durchbrochen und fügt sich gerade deshalb bruchstückhaft wie ein großes Gedächtnisgemälde zusammen, das der Verfasser selbst wohl am ehesten mit einem Palimpsest in Beziehung gebracht hätte. Hier schon wird bereits Kiš‘ literarische Methode sichtbar, die in seinen späteren Arbeiten ihre singuläre Strahlkraft gefunden hat und die in „Psalm 44“ kraftvoll auf sich aufmerksam macht. Die dem Gedächtnis immanenten Überschreibungen sind Danilo Kiš‘ großes Lebens- und Literaturthema, das er in seinem schmalen, aber weltweit unter Kennern hochangesehenem Werk immer wieder umkreist hat und das ihm, so hatten es sich nicht nur seine Bewunderer Joseph Brodsky oder Susan Sontag gewünscht, wohl auch irgendwann den Literarturnobelpreis hätte einbringen können, wäre er nicht vor dreißig Jahren im Alter von nur vierundfünfzig Jahren in Paris verstorben. 1935 kam er in Subotica zur Welt, einer mehrsprachigen Stadt in der von vielen Völkern und Religionen geprägten Vojvodina, die von Beginn an Auskunft über seine biographischen Lebenskoordinaten gibt. Paris, das ihm 1989 zum Sterbeort wurde und am Ende auch unfreiwillig Zufluchtsort war, scheint deshalb keinem psychologisch belanglosem Zufall geschuldet zu sein, denn hierhin rettete er sich vor den diffamierenden Angriffen nationalistischer wie antisemitischer Kleingeister aller Couleur, denen er, ein autonomer Mensch mit eigener Denkfarbe, der die beiden menschenverachtenden Lagersysteme des 20. Jahrhunderts als einer der ersten europäischen Intellektuellen zeitgleich im Blick hatte, stets als Provokation erschienen war. „Sobald eine Gemeinschaft dich annimmt, stelle dich in Frage“, hatte er einmal geschrieben und damit seinen geistigen Lebensort jenseits aller Sicherheiten als unabhängig denkender Solitär benannt. Es passt zu seiner Originalität, dass am Anfang seines Schreibens eine Frau als Erzählerin steht, die Überlebende, Zeugin und Erinnernde in einem ist. Der Mensch mit Gedächtnis ist bei Kiš also von Beginn an jemand, der die Welt trägt und aushält, weil er sie nicht retten, sondern des Geschehenen nur gedenken kann, indem er in einer Art Immerzeit, einem verschmelzenden Augenblick großer Luzidität lebt. In diesem Gewahrsein sind Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ein einziger untrennbarer Zeitstrom. So nur wird auch der Mensch in der Summe seiner Ganzheit und Bestimmung das, was er in Wahrheit ist. Nicht zufällig wählt Kiš hierfür in seinem bewegenden Frühwerk „Psalm 44“ Maria als das alles Verbindende, was die Gewalt seines Jahrhunderts zu trennen versucht hat. Die Mutter eines Kleinkindes ist Hüterin des Gedächtnisses. Sie, die Jüdin ist, weil andere sie zu dieser Anderen machen, erinnert sich auf der Flucht an eine Begebenheit aus ihrer Kindheit mit einem Mädchen, das ihr brüsk zu verstehen gibt, alle Juden seien an der Kreuzigung Christi beteiligt gewesen, denn ein jeder habe „wenigstens einen Nagel gereicht“. Das Erlebnis dieser Urszene christlicher Schuldphantasie, die den Antisemitismus über die Zeiten hinweg genährt hat, rüttelt Maria auf, aber anders als die dabei anwesende Mutter, will das Kind darüber zu Hause alles dem Vater erzählen, es will sprechen. Später, als diese Erinnerung Teil ihres Befreiungsversuches aus dem Lager wird und die Flucht zu gelingen scheint, trifft sie auf einem Hof eine Frau, die sie bei sich aufnimmt und bei ihr arbeiten lässt. Bei dieser ersten Begegnung lamentiert die Hofbesitzerin lautstark über die schlechten Zeiten, an denen die Juden schuld seien, sie hätten alles kaputtgemacht und ihr Mann habe immer gesagt, sie seien auch verantwortlich für den Krieg. Prompt sagt Maria, ja, jeder von denen habe wenigstens einen Nagel gereicht, woraufhin sie von der Frau für eine Protestantin gehalten wird. Diese plötzliche Eingebung, jenen Satz aus ihrer Kindheit zu wiederholen, rettet ihr endgültig das Leben und sie darf auf dem Hof bleiben, weil sie als Jüdin intuitiv versteht, dass ihr nur so ein neuer Anfang möglich ist. Kiš selbst hat sich über sein Frühwerk kritisch geäußert und es zeitweise als zu lyrisch verworfen, es habe ihm an der Würze namens Ironie gefehlt. Er, der Sohn einer montenegrischen Christin und eines ungarischen Juden, der in Auschwitz ums Leben kam, hat das Thema der Schoa nie wieder auf eine so ungeschützte Weise wie hier aufgegriffen. Doch zeitlebens hat er das zu gestalten versucht, was er Marias Vater, einem Trinker, in den Mund gelegt hat, als er er diesen über das Massaker von Novi Sad sprechen und also an jene „kalten Tage“ erinnern ließ, an denen die Juden massenweise ins Eis der Donau gestoßen oder reihenweise am Ufer erschossen wurden. Dieser Vater kann immer noch sagen, dass sein Gott „nur eine Inkarnation der Gerechtigkeit und Menschenliebe und Güte ist; und der Hoffnung“. Vielleicht kann er deshalb seiner Tochter etwas Entscheidendes beibringen, das leider bis heute Gültigkeit hat. Nicht der zum „Anderen“, also zum Fremden Gemachte sorgt für den Unterschied zwischen den Menschen, sondern der, der den Unterschied benennt: „… und das genügt schon, dass du Leid erfährst“, sagt Marias Vater im Zusammenhang mit jenem Mädchen, das behauptet hatte, jeder einzelne Jude habe bei der Kreuzigung Christi „wenigstens einen Nagel gereicht.“ Im Gegensatz zu dieser Verortung des Anderen in eine kollektive Kategorie hat Kiš stets die Andersheit des Einzelnen hervorgehoben, der in dem, was er različnost nannte, seine unverwechselbare Erscheinung zeigt. Jeder Mensch sei ein Stern für sich. Ohne es vielleicht in dieser Tragweite damals gesehen zu haben, das Buch ist 1962 entstanden, hat Kiš nicht nur ein Werk über das Leiden der Juden unter nationalsozialistischer Verfolgung und die Lager der Nazis geschrieben, sondern auch eine Art europäischen Rückkehrer-Mythos verfasst. Denn alle, die überlebt und wie Maria mit ihrem kleinen Kind zu den Tätern zurückgekehrt sind, haben das bewiesen, was Hannah Arendt einst mit dem Anfang und dem Geborensein in Verbindung gebracht hat – „wir können etwas beginnen, weil wir Anfänge und Anfänger sind“. Dieses Neue haben die europäischen Juden in einem pionierhaften Anfang nach dem Zweiten Weltkrieg gewagt und Kiš war ihr literarischer Zeuge erster Stunde. Hier und dort erfindet er in „Psalm 44“ historisch nicht belegte Einzelheiten, die Ilma Rakusa in ihrem umsichtigen wie von tiefer Menschenfreundlichkeit durchdrungenem Nachwort eingehend beleuchtet. Man könnte ihm wegen dieser faktischen Unzulänglichkeiten den Vorwurf der Ungenauigkeit machen, wenn man nicht weiß, dass er die Phantasie des Schriftstellers als eine Schwester der Lüge verstanden hat. Weiß man aber, wie es bei Ilma Rakusa der Fall ist, um diesen ethischen Kompass in seinem metaphysisch durchdrungenen Denken, so ahnt man, dass er damals schon etwas verstanden hat, was heute einigen jüngeren Autoren nicht in den Sinn kommt – dass der Kitsch und seine moralischen Verwerfungen dort entstehen, wo der schreibende Mensch nur fabuliert. Das aber ist die Sache dieses Autors nicht, denn seine Maria weiß schon als Kind aus eigener Anschauung längst alles, man muss ihr keine verbogenen Erklärungen für die Ermordung der mitteleuropäischen Juden liefern. In ihrer Haltung erinnert sie an die kürzlich im Alter von neunzig Jahren verstorbene Philosophin Agnes Heller, die ebenfalls als jüdisches Kind alles verstanden hat, was um sie herum geschah und die mehrmals der Deportation und einem Erschießungskommando an der Donau entkam. Der Hass sei ein Atavismus der Horde, die menschliche Intoleranz gehe allen ethnischen, rassistischen und nationalen Entitäten voraus, so heißt es einmal in „Psalm 44“. Dieses Momentum der Intoleranz ist es, das Kiš in seinem Schreiben nie aus den Augen verloren hat. Sein melodisches und tiefgründig klares, fast tänzerisches Serbokroatisch (es ist ganz wunderbar, dass der Verlag diese Ursprungssprache so benannt hat) hat die Übersetzerin Katharina Wolf-Grieshaber in ein musikalisches und genaues Deutsch übertragen, das nicht nur rhythmisch, sondern auch geistig das Original würdigt, eine Arbeit, die kostbar und beeindruckend ist. Vielleicht mussten all diese Jahrzehnte vorbeigehen, damit dieses Buch, mit seinen großen Ambitionen, gerade heute und in einer Epoche dem deutschen Leser zugänglich ist, in der die menschliche Intoleranz, wie Kiš sie hier beschrieben hat, wieder versucht, die Wurzeln der Schönheit und also die menschlichen Ganzheit vergessen zu machen. Nur die Verletzlichen können von der Härte dieses Unterfangens berichten. Nur die Verletzlichen haben ein Gedächtnis. Die Intoleranten hingegen arbeiten daran, die Erinnerung abzuschaffen.
Danilo Kiš, Psalm 44, Aus dem Serbokroatischen von Katharina Wolf-Grieshaber. Hanser Verlag, München 2019, 135 Seiten, 20 Euro
FAZ, 12.10.2019
